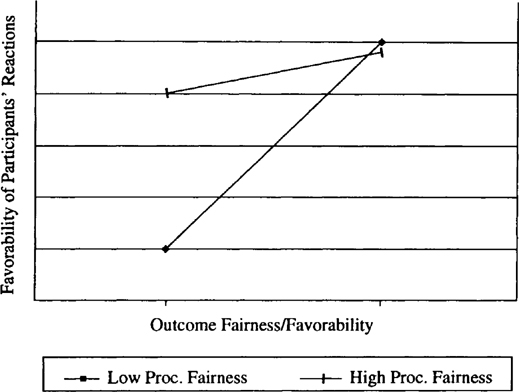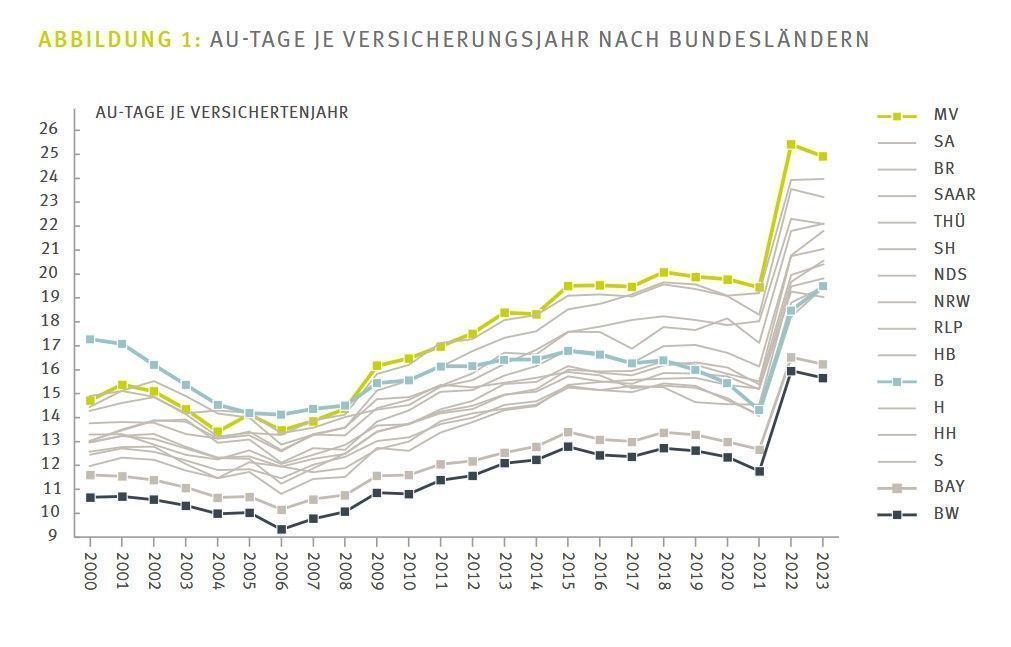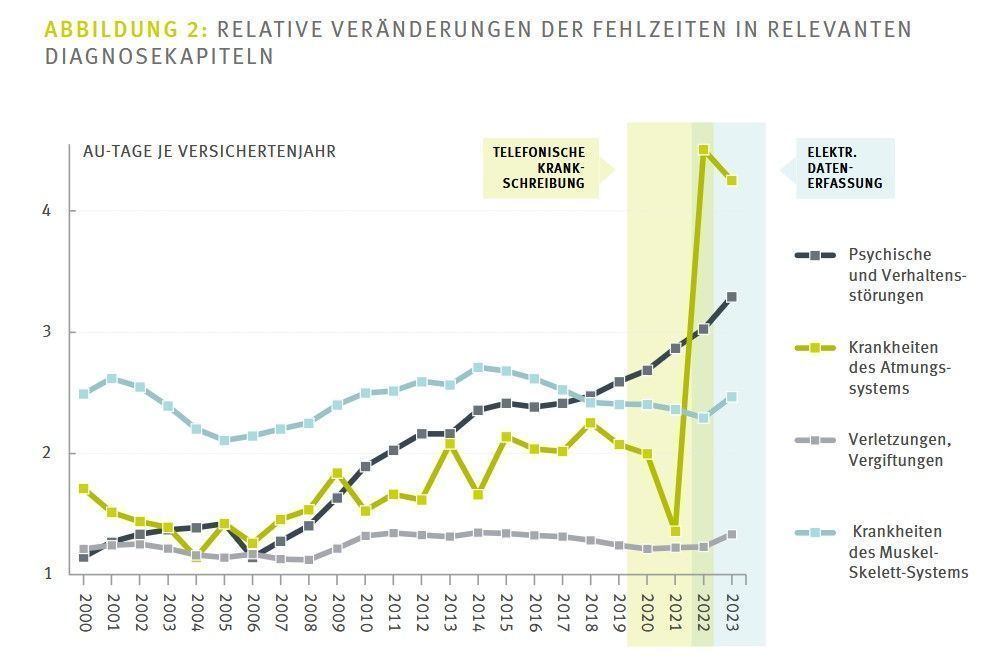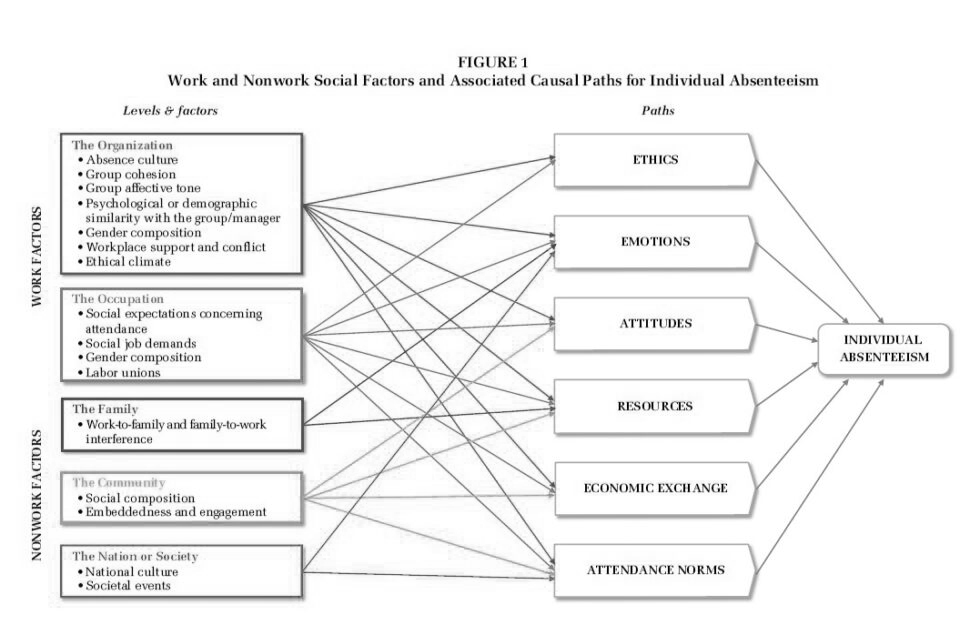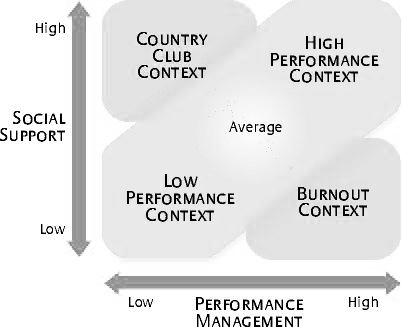Trump vs. Musk: Narzissmus und die Unendlichkeit der Egos
Trump vs. Musk – Wenn Narzissmus auf Narzissmus trifft
Zwei Alphatiere. Zwei Egos im XXL-Format. Zwei Männer, die sich selbst feiern – aber gegenseitig halt nur bei Sonnenschein.
👉 Warum die Zusammenarbeit zwischen Donald Trump und Elon Musk zum Scheitern verurteilt war?
👉 Wie man mit narzisstischen Menschen umgeht und was wir dabei von Friedrich Merz lernen können?
👉 Welche Optionen Unternehmen haben?
Im Interview mit dem Handelsblatt geht es genau darum. Wir sprechen über toxische Dynamiken in der Führung, die Entstehung narzisstischer Persönlichkeitsstrukturen und warum ein „Ich zuerst!“-Mindset selten gut für Zusammenarbeit ist. 🤝❌
Hier geht’s zum Interview:
🎙️Interview im Handelsblatt: Trump vs. Musk – Macht Narzissmus Zusammenarbeit unmöglich?
Ergänzung: Ist autoritäre Führung auf einmal wieder hip?
Letzte Woche ging das Handelsblatt dieser Frage nach und interviewte unter anderem Heike Bruch, Dr. Nicolas von Rosty und mich. Nun flattert mir heute, gnah, eine wahnsinnig tolle Studie zu genau diesem Thema auf den Tisch.
Spoiler vorweg: Je bedrohlicher eine Konfliktsituation, desto größer unsere Sehnsucht nach einem autoritären Leader. 25 Länder, über 5000 Befragte, ein mega cooles (experimentelles) Design. Ganz toll!
👉Die zentrale Botschaft? Intergruppenkonflikte aktivieren archaische Instinkte in uns. Wir bevorzugen plötzlich „starke Persönlichkeiten“, die dominant und kompromisslos auftreten. Vereinfacht gesagt: Krisen wecken den inneren Höhlenmenschen, der sich nach klarer Führung sehnt.
👉 Klingt vertraut? Ist es leider auch. Beispiele gibt’s genug: Putin, Orban, Erdoğan. Autoritäre Typen boomen nicht trotz, sondern wegen Krisen. Warum marschiert die Nationalgarde zu Tausenden in LA auf? Genau.
👉 Was lernen wir daraus? Führungskräfte, die lieber demokratisch und partizipativ führen möchten, brauchen in Krisenzeiten mehr denn je Überzeugungskraft und gute Argumente. Sonst übernehmen schnell wieder die Alpha-Tiere.
Neugierig geworden? Hier die Studie: "Cross-cultural evidence that intergroup conflict heightens preferences for dominant leaders: A 25-country study"
Literatur:
- Narzissten überschätzen systematisch ihre Fähigkeiten, ignorieren Risiken und lassen sich schwer korrigieren:
- Grijalva, E., & Newman, D. A. (2015). Narcissism and counterproductive work behavior (CWB): Meta‐analysis and consideration of collectivist culture, Big Five personality, and narcissism's facet structure. Applied Psychology, 64(1), 93-126.
- Nevicka, B., Van Vianen, A. E., De Hoogh, A. H., & Voorn, B. (2018). Narcissistic leaders: An asset or a liability? Leader visibility, follower responses, and group-level absenteeism. Journal of Applied Psychology, 103(7), 703.
- Narzissmus ist Fluch und Segen: Liu, X., Zheng, X., Li, N., Yu, Y., Harms, P. D., & Yang, J. (2022). Both a curse and a blessing? A social cognitive approach to the paradoxical effects of leader narcissism. Human Relations, 75(11), 2011-2038.
- Es gibt unterschiedlichen Formen von Narzissmus: Liu, C., Chen, Y., & Li, F. (2024). Grandiose narcissism and organizational citizenship behaviors: the mediational role of prosocial motivation. Current Psychology, 43(10), 8675-8677.
- Auswirkungen von Narzissmus in der NBA: Grijalva, E., Maynes, T. D., Badura, K. L., & Whiting, S. W. (2020). Examining the “I” in team: A longitudinal investigation of the influence of team narcissism composition on team outcomes in the NBA. Academy of Management Journal, 63(1), 7-33.
- Narzissmus wirkt sich zunehmend negativ aus: Lynch, J., & Benson, A. J. (2024). Putting oneself ahead of the group: The liability of narcissistic leadership. Personality and Social Psychology Bulletin, 50(8), 1211-1226.
- Warum Friedrich Merz klug gehandelt hat: Grapsas, S., Brummelman, E., Back, M. D., & Denissen, J. J. (2020). The “why” and “how” of narcissism: A process model of narcissistic status pursuit. Perspectives on Psychological Science, 15(1), 150-172.
- Narzisstische Persönlichkeiten sind in Führungsetagen überdurchschnittlich vertreten: Braun, S. (2017). Leader narcissism and outcomes in organizations: A review at multiple levels of analysis and implications for future research. Frontiers in psychology, 8, 260159.
- Personalentwicklung & Narzissmus mittels “confident humility”: Owens, B. P., Wallace, A. S., & Waldman, D. A. (2015). Leader narcissism and follower outcomes: the counterbalancing effect of leader humility. Journal of Applied Psychology, 100(4), 1203.
- Intergruppenkonflikte erhöhen Präferenz für dominante Führung: Laustsen, L., Sheng, X., Ahmad, M. G., Al-Shawaf, L., Banai, B., Banai, I. P., Barlev, M., Bastardoz, N., Bor, A., Cheng, J. T., Chmielińska, A., Cook, A., Fousiani, K., Garfield, Z. H., Ghossainy, M., Ha, S. E., Ji, T., Jones, B. C., Kandrik, M., Kanu, C. C., Kenrick, D. T., Kordsmeyer, T. L., Martínez, C. A., Mazepus, H., O, J., Onyishi, I. E., Pawlowski, B., Penke, L., Petersen, M. B., Ronay, R., Sznycer, D., Palomo-Vélez, G., von Rueden, C. R., Waismel-Manor, I., Wiezel, A., & van Vugt, M. (2025). Cross-cultural evidence that intergroup conflict heightens preferences for dominant leaders: A 25-country study. Evolution and Human Behavior, 46, 106674. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2025.106674
Bildquelle: https://unsplash.com/de/fotos/blau-weisse-zeichentrickfigur-XClNDg9Z9Ag